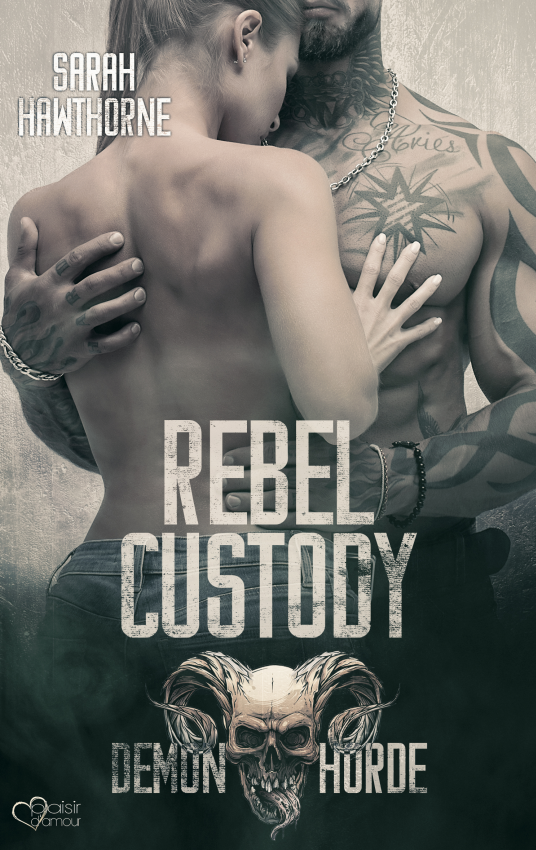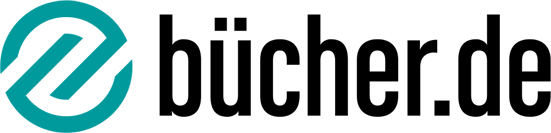paperback & ebook
Print: 978-3-86495-560-0
ebook: 978-3-86495-561-7
Print: 16,90 €[D]
ebook: 6,99 €[D]
Demon Horde MC: Rebel Custody
Sarah Hawthorne
Inhaltsangabe
Regeln und Gesetze zu brechen ist nichts Neues für den Demon Horde Motorradclub. Aber um das Sorgerecht für seinen Sohn zu bekommen, geht Clubmitglied Skeeter ausahmsweise den legalen Weg. Die Anwältin Miriam Englestein soll seine Probleme lösen - doch stattdessen beschert sie ihm Probleme ganz anderer Art. Ein Blick auf Miriam und Skeeters gespielte Gutmenschen-Fassade zerbröckelt, denn wo seine Seele verdorben ist, ist Miriams Seele rein und weiß. Skeeter will seine zugeknöpfte Anwältin erst auf sein Motorrad, und dann in sein Bett ziehen.
Alles, was Miriam interessiert, ist ihr Job auf der richtigen Seite des Gesetzes. Männer spielen in ihrem Leben keine Rolle. Vor allem mit einem Motorradclub voller Gesetzesbrecher will sie keinesfalls in Verbindung gebracht werden, doch ihr Vater steht auf der Gehaltsliste des Demon Horde MC. Nachdem ihre erste Begegnung mit Skeeter in einem Pfefferspray-Massaker endet, ist irgendetwas an Skeeters Bitte - an Skeeter selbst - dem sie sich nicht verschließen kann. Obwohl sie Skeeter gerne nachgeben und ihn unglaublich leidenschaftliche und köstliche Dinge mit ihrem Körper anstellen lassen möchte, hat sie nicht nur Angst davor, ihre Kanzlei, sondern auch ihr wehrloses Herz aufs Spiel zu setzen.
Schnell verschwimmen die Grenzen zwischen Geschäftlichem und Privatem, und während Miriam und Skeeter ihrer Anziehung nachgeben, kommt ein Stalker Miriam gefährlich nahe ...
Über die Autorin
Sarah Hawthorne lebt im pazifischen Nordwesten, wo sie zu viel Kaffee trinkt, viele Urlaube plant und Liebesromane schreibt. Zu ihren natürlichen Lebensräumen gehören ihr Garten und die örtliche Bibliothek. Sarah Hawthorne hat einen Bachelor-Abschluss von der California State Polytechnic University of...
mehr über die Autorin erfahren
Weitere Teile der Demon Horde MC Serie
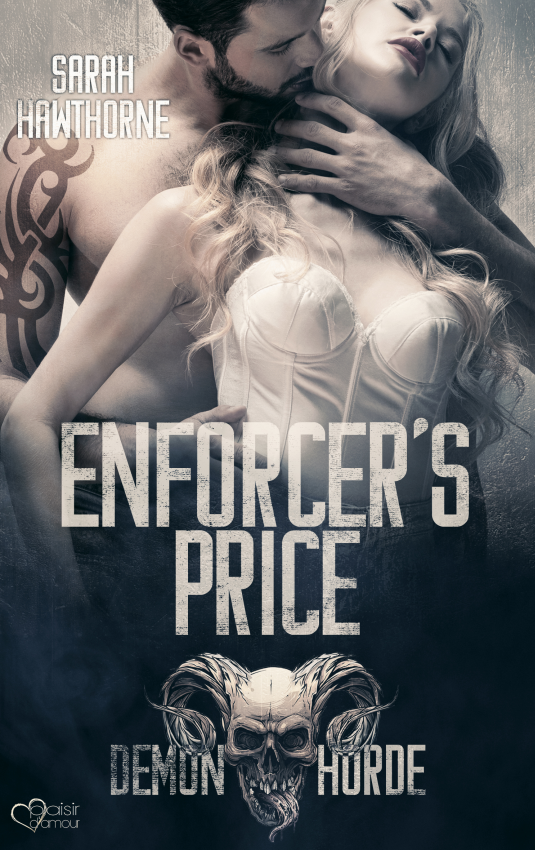
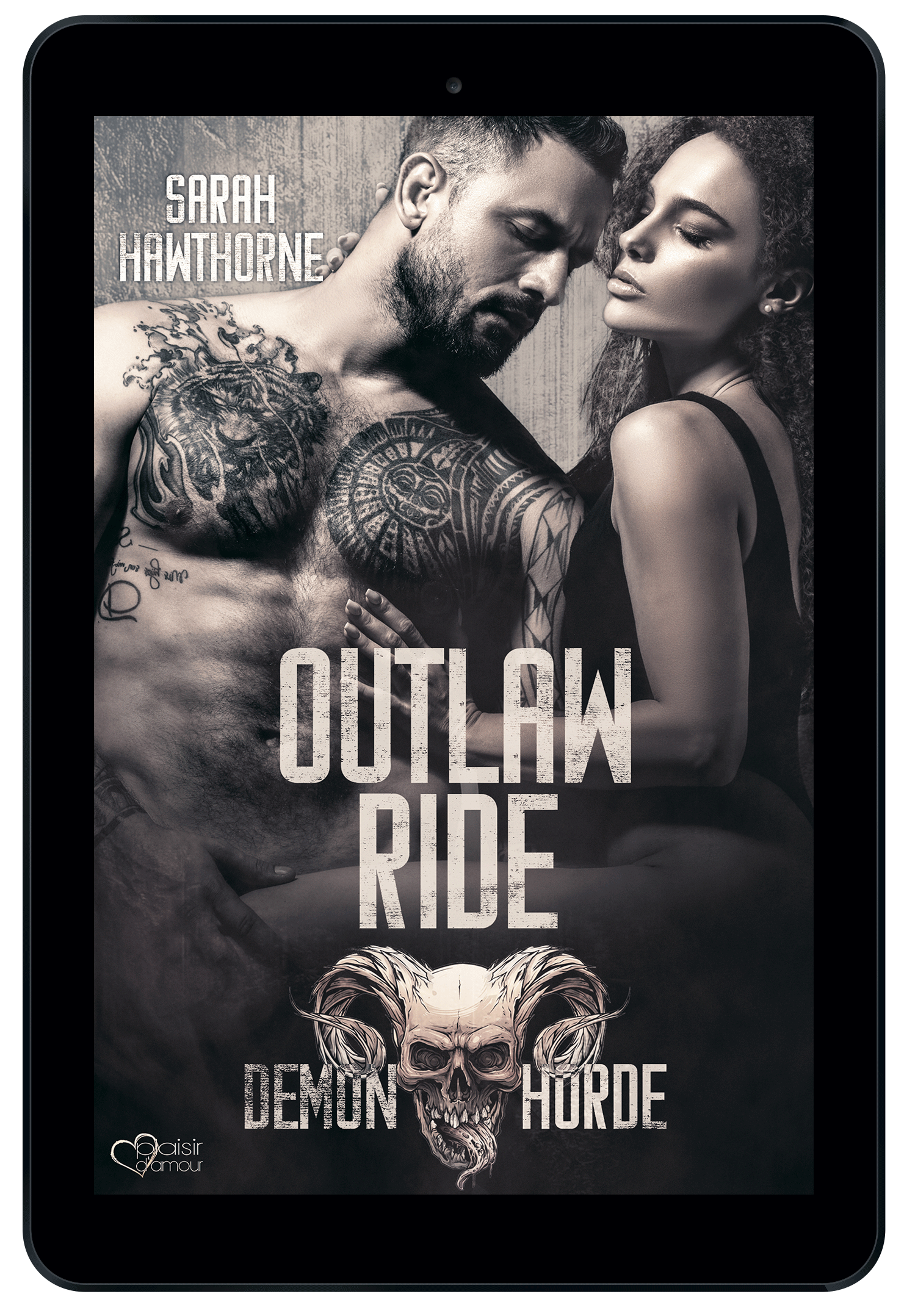
Leseprobe
Miriam
Sheena räusperte sich an der Tür zu meinem Büro. Sie hatte ihren Notizblock nicht dabei, also musste es das Ende des Tages sein. Ich hatte das Zeitgefühl verloren. In meinem winzigen Büro mit seinen Glaswänden, durch die jeder hereinsehen konnte, gab es keine Fenster, aber ich war die Tochter des Chefs, daher hatte ich ohnehin keinen Anspruch auf Privatsphäre.
„Ich bin auf dem Sprung.“ Sheena machte ein trauriges Gesicht. „Ist er immer noch nicht da?“
Gott sei Dank gab es Sheena. Der Rest von Dads Firma war spießig und steif. Aber ich hatte meine eigene Assistentin einstellen dürfen. Im Büro...
vollständige Leseprobe
...wurde manchmal über ihre blauen Haare gelästert, doch sie war eine hervorragende Anwaltsgehilfin – und meine Freundin.
„Danke.“ Ich lächelte. „Ich bin sicher, er verspätet sich nur.“
„Ich habe das Telefon der Rezeption an deinen Schreibtisch weitergeleitet.“ Sie hängte sich ihre Handtasche höher auf die Schulter. „Vergiss nicht, es zurückzustellen, wenn du gehst, sonst bekommst du alle Anrufe am Morgen.“
Ich nickte. Die Firma meines Vaters hatte vier Partner und fünfzehn Mitarbeiter, von denen ich einer war. Die Mandanten riefen morgens immer an, um sich über ihre Fälle zu informieren. Die meisten davon waren straf- oder gesellschaftsrechtlicher Natur, doch ich bearbeitete auch Familienrecht. Mein Stundensatz war niedriger als der der anderen, aber wenigstens verteidigte ich keine Mörder.
„Ich mach das schon. Wir sehen uns dann morgen.“ Ich winkte sie weg.
Um siebzehn Uhr dreißig packte ich meine Sachen zusammen. Mein Kunde hatte anderthalb Stunden Verspätung und es war Zeit für mich zu gehen. Sobald ich zu Hause war, hatte ich noch mehr Arbeit vor mir.
Ich fuhr mir durch die Haare, löste meinen Dutt und griff nach meiner Tasche. Ich schlüpfte aus meinen hohen Schuhen und zog mir flache an – meine kleine Rebellion am Ende des Tages. Ich hasste das Geräusch, das meine Absätze machten, wenn ich abends durch das leere Parkhaus lief.
Ich bog links in den Gang ein und ging in Richtung Tiefgarage.
Tapp, Tapp, Tapp.
Ich blieb stehen. War jemand mit mir auf dem Flur? Ich warf einen Blick auf mein Mobiltelefon. Keine verpassten Anrufe von meinem abwesenden Kunden. Dann war er es wohl nicht.
Meine Schritte hallten von den kahlen Wänden und dem Linoleumboden wider, während ich weiterging. Die Geräusche wurden immer lauter und kamen näher. Abends lief niemand diesen Flur entlang. Verfolgte mich jemand? Ich verdrehte die Augen über meinen Gedankengang. Wahrscheinlich war es nur das Reinigungsteam oder ein Wachmann. Ich versuchte, es zu verdrängen, aber ich beschleunigte meinen Schritt.
Die Geräusche kamen in schneller Folge den Flur hinunter.
Ich prallte gegen die Brandschutztür, die zur Garage führte, und rannte direkt los.
„Hey!“, rief eine männliche Stimme hinter mir.
Scheiße, mein Auto war zu weit weg. Ich würde es nie schaffen. Zeit für einen neuen Plan. Während ich sprintete, griff ich in meine Handtasche. Sonnenbrille, Lippenstift, Portemonnaie, alles hüpfte herum wie verrückt. Mein Geldbeutel sprang aus der Tasche und flog zu Boden. Ich rannte weiter. Meine Finger schlossen sich um den kalten Zylinder.
Jackpot. Ich holte das Pfefferspray aus meiner Handtasche.
„Ich will nur mit Ihnen reden!“
Es war die Stimme eines Mannes mit einem seltsamen Akzent. Sie klang fast europäisch, aber nicht ganz. Ich würde es nie schaffen, vor ihm wegzulaufen. Vielleicht war das Überraschungsmoment zu meinen Gunsten. Ich blieb stehen und drehte mich um. Zielte. Sprühte.
Das Pfefferspray kam in einem Strahl heraus und verbrannte mein Gesicht. Ich hatte die verdammte Flasche verkehrt herum gehalten. Tränen brannten bereits in meinen Augen, aber das war mir egal. Ich musste ihn erwischen. Meine Hände zitterten, als ich den oberen Teil der Flasche abtastete, um herauszufinden, wohin ich sie richten sollte.
„Hey, beruhigen Sie sich. Ich werde Ihnen nichts tun. Ich will nur reden“, sagte der Mann wieder.
Es war mir egal, warum er hier war. Ich wollte nur, dass er verschwand. Ich schnappte nach Luft, drehte die Flasche und drückte erneut auf den Knopf. Diesmal erwischte ich ihn. Er schrie auf und hielt sich die Hände vors Gesicht. Ich stoppte jedoch nicht, sondern stolperte weiter zu meinem Auto.
Das Brennen in meinen eigenen Augen wurde stärker und meine Sicht begann zu verschwimmen. Meine Tränen brannten wie Säure in meinen Augen und auf meinen Wangen. Ich musste einfach nur zu meinem Auto kommen. Dort konnte ich mich wenigstens hinsetzen und die Tür abschließen.
Seine Finger schlossen sich um meinen Unterarm, ich fiel und landete hart auf dem Asphalt.
„Mein Gott, Lady“, keuchte er. „Wir waren um sechzehn Uhr verabredet.“
Wir rangen beide um Atem und mein Herz schlug nicht mehr so schnell. Er war der Termin, der sich verspätet hatte? Shit. Ich hatte einen Kunden besprüht. Dad würde nicht glücklich darüber sein.
Ich hielt die Dose vor mich, und schaute ihn durch meine Tränen hindurch an. Er hatte zotteliges Haar und trug eine schwarze Lederweste. Ich musste sicher sein, dass er tatsächlich mein Mandant war und nicht ein Vergewaltiger, der im Parkhaus auf eine ahnungslose Frau wartete.
„Ach ja?“ Ich schnappte nach Luft und wischte mir die brennenden Tränen weg. „Wer hat Sie weiterempfohlen?“
Meine Kehle, meine Nase, meine Augen, sogar meine Ohren brannten, mein Sehvermögen verschwamm.
„Er ist der Anwalt unseres Clubs. Demon Horde, Tacoma Chapter. Er hat meinen Fall seiner Tochter Miriam Englestein übertragen.“ Er griff den Saum seines Shirts und tupfte sich damit über das Gesicht. „Ich war zu spät und sah Sie den Flur entlanggehen, als ich ankam.“ Er wischte sich die Tränen ab, die ihm die Wangen herabliefen. „Packen Sie bitte das verdammte Pfefferspray weg. Ich wollte Sie nicht erschrecken.“
Gerald Englestein war der beste Strafverteidiger zwischen Seattle und Los Angeles. Wenn man sich aus einer Mordanklage herauswinden wollte, rief man ihn an, und dann bezahlte man ihn. Und zwar viel. Mein Vater mochte Luxusjachten und schnelle Autos und er hatte einen Stundensatz, der das alles finanzierte. Er verlangte mehr für eine Stunde, als ich in einer Woche verdiente.
Die meiste Zeit waren Dads Kunden genauso reich wie er selbst. Sie spielten Golf, während sie ihren Fall besprachen, oder aßen drei Stunden lang in einer Martini-Bar zu Mittag. Aber nicht alle waren aus dem Countryclub. Dad hatte schließlich Rechnungen zu berappen und das organisierte Verbrechen zahlte gut. Die Mafia war vor allem an der Ostküste zu Hause, also spezialisierte sich Gerald-Englestein-Esquire auf Motorradclubs und Straßenbanden – im Grunde jeden, der im Voraus bar bezahlen konnte.
Nachdem ich das College abgeschlossen hatte, hatte ich die Stelle in der Kanzlei meines Vaters mit der Voraussetzung angenommen, dass ich niemals Strafsachen übernehmen würde. Ich wollte einfach keine Mörder verteidigen. Mein Vater steckte mich ins Familienrecht und übertrug mir die Scheidungen und Sorgerechtsstreitigkeiten. Solche bekamen wir nicht oft, nur etablierte Mandanten, die bereits ihren Vorschuss für ein anderes Problem bezahlt hatten, wurden von uns in dieser Angelegenheit vertreten.
Da saß ich nun mitten auf dem Parkplatz mit einem von Dads Bargeld-Kunden, keuchend und weinend wegen dem Pfefferspray. Sein Haar reichte ihm bis zu den Schultern und er trug eine schwarze Lederweste und verblichene Jeans. Dieser Typ würde sich nicht so bald unter die Oberschicht von Seattle mischen.
„Wenn Sie der Kunde meines Vaters sind, warum hat er Sie dann zu mir geschickt?“ Ich hielt die Dose immer noch fest in meinem Griff.
Er wischte sich mit dem Handrücken über die Augen. „Ich brauche einen Anwalt für einen Sorgerechtsfall. Für mein Kind.“ Er atmete ein und aus. „Der beste Weg, mit Pfefferspray umzugehen, ist, es einfach auszuweinen. Haben Sie ein paar Taschentücher?“ Ich fischte eine Packung aus meiner Handtasche und reichte sie ihm. Meine Haut kribbelte. War er schon einmal mit Pfefferspray besprüht worden? Hoffentlich war er nicht gefährlich.
„Gibt es eine Möglichkeit, dass Sie mich wieder reinlassen, damit ich die Toilette benutzen kann?“, fragte er und tupfte sich die Wangen ab. „Ich glaube, ich habe das Zeug in meinen Haaren, und ich muss einen Helm tragen, wenn ich nach Hause fahre.“
„Es gibt ein Fitnessstudio mit Duschen“, erklärte ich. „Dort können wir uns waschen.“
Ich weinte immer noch von dem Pfefferspray, als wir durch das Gebäude gingen. Meine Haut kribbelte bei jedem Schritt. Logischerweise wusste ich, dass der Mann neben mir ein Kunde war und mir nicht wehtun würde, aber das kleine Mädchen, das in dem gutbürgerlichen Viertel Queen Anne in Seattle aufgewachsen war, hatte große Angst.
Das Trainingsstudio befand sich im Erdgeschoss, also mussten wir nach oben gehen. Da ich mich nicht in einem geschlossenen Raum mit den Überresten des Pfefferspraydampfes aufhalten wollte, verzichtete ich auf den Aufzug und entschied mich für das Treppenhaus. Unsere Schritte hallten wider, während wir hinaufgingen, was deutlich machte, wie allein ich mit diesem Kunden war. Nur er und ich. Keiner, der mich schreien hören würde.
„Also, woher kommen Sie?“, fragte ich im Bemühen, Konversation zu betreiben. Sein Akzent war ungewöhnlich und ich konnte ihn nicht zuordnen.
„Ich bin in Louisiana aufgewachsen“, antwortete er. „Aber jetzt lebe ich in Tacoma.“
Ich zitterte. Tacoma hatte eine der höchsten Mordraten im ganzen Land. Er war ein Kunde, erinnerte ich mich. Er verdiente denselben Kundenservice, den ich jedem angedeihen ließ, egal wie er bezahlte. Ich wiederholte das noch einmal, als wir schweigend den Treppenabsatz erreichten.
Auf der letzten Stufe blieb ich mit dem Zeh hängen und stolperte. Ich griff nach dem Geländer, um mich zu stützen, aber etwas packte meinen Arm.
Das war er. Er hatte nach meinem Arm gegriffen und mich auf den Treppenabsatz gezogen, um mich vor dem Sturz zu bewahren. Wir standen einen Moment dort und seine Hand ruhte auf meiner Schulter. Sein Griff war fest, tat aber nicht weh. Ich wusste, dass er mich nicht fallen lassen würde.
Seine Augen waren braun, honigfarben. Er hatte ein paar Sommersprossen auf der Nase. Ich wollte den Rest seines Gesichts sehen, doch es war von einem riesigen Bart bedeckt. Ich hatte noch nie einen so wilden Bart gesehen.
„Geht es Ihnen gut?“ Er blickte mich suchend an. „Ich dachte schon, ich verliere Sie auf der Treppe.“
„Alles gut.“ Ich zog am Kragen meines Pullovers. Mir musste heiß geworden sein, als ich die Stufen hinaufgegangen war. Ich machte einen Schritt auf die Tür zu. „Zum Trainingsraum geht es da lang.“
Wir kamen am Cardio-Trainingsbereich vorbei, wo die Laufbänder aufgereiht und leer waren.
Ich blieb vor der Männerumkleide stehen.
„Ich war noch nie da drin, aber neben den Damenduschen liegen Handtücher, also nehme ich an, dass es für die Männer dasselbe ist.“ Ich runzelte die Stirn. Ich hatte den armen Kerl mit Pfefferspray besprüht, und das war alles, was ich tun konnte? „Rufen Sie mich einfach, wenn Sie Hilfe brauchen.“
„Ich bin sicher, dass ich unter der Dusche keine brauchen werde“, erwiderte er.
Dann lächelte er, und ich spürte, wie mir die Knie zitterten. Grübchen zeigten sich durch den schweren Bart und sein ganzes Gesicht veränderte sich. Er war nicht mehr der bedrohliche Typ, der mich im Parkhaus gejagt hatte.
Er verschwand in der Umkleidekabine. Nachdem ich in die Damentoilette geflüchtet war, starrte ich mich im Spiegel an. Mein Haar war ein einziges Durcheinander und auf der Seite zerzaust, wo mich das Spray getroffen hatte. Das war völlig inakzeptabel. Nach einer Dusche lieh ich mir einen der Haartrockner des Trainingsstudios und schaffte es, meine Strähnen zu einem Dutt zu flechten. Wenigstens sah ich jetzt professionell aus.
Da er nicht wusste, wo sich mein Büro befand, wartete ich in der Halle, bis er aus der Umkleidekabine kam. Ohne Hemd. Ich erschrak. Eine große Tätowierung bedeckte seine Schulter und lief seinen Arm hinunter. Auf seinem anderen Arm hatte er ein Pin-up im Stil der 1940er-Jahre mit dunklem Haar.
„Oh.“ Er neigte den Kopf und legte sich ein Handtuch um die Schultern. „Tut mir leid, mein Shirt ist durchnässt und ich habe nichts anderes dabei. Ich wollte Sie nicht erschrecken.“
„Sie haben mich nicht erschreckt.“ Ich schnaubte. „Ich habe schon mal einen Mann oben ohne gesehen.“
„Nur einen?“, fragte er lachend.
Ich presste die Lippen zusammen und versuchte zu lächeln. Kundenservice. Ich konnte das. Nur weil er umwerfend gut aussah, hieß das nicht, dass ich mich in eine sabbernde, liebeskranke Idiotin verwandeln würde.
„Mein Büro ist hier entlang.“ Ich drehte mich um und ging zurück zum Treppenhaus, ohne darauf zu warten, dass er mir folgte. Meine Wangen waren heiß, und ich war mir sicher, dass das nicht von meiner Dusche kam. Ich hantierte mit meiner Handtasche und zog im Gehen meine Strickjacke aus. In meinem Büro würde es nicht kühler sein.
Ich setzte mich an meinen Schreibtisch und lud ihn ein, auf dem ledernen Gästesessel Platz zu nehmen. Ich lächelte, griff nach einem Notizblock und tat so, als sei es völlig normal, dass ein Kunde halbnackt in meinem Büro saß. Vollkommen normal. Kundenbetreuung. Ich konnte das.
„Jean Luc Devaneaux.“ Er streckte mir die Hand entgegen. „Freut mich, Sie kennenzulernen, Ma’am.“
„Miriam Englestein.“ Ich nahm seine Hand. Genau wie beim Treppenabsatz war sein Griff fest, aber nicht hart. Ich setzte mein professionellstes Lächeln auf. „Ich möchte mich für das, was passiert ist, entschuldigen. Ich hoffe, wir können es hinter uns lassen und eine sehr erfolgreiche Arbeitsbeziehung haben.“
„Klingt großartig.“ Sein Lächeln wirkte allerdings nicht mehr ganz so strahlend wie noch im Flur.
Ich runzelte die Stirn. Warum hatte sich sein Lächeln verdunkelt? Hatte ich etwas falsch gemacht?
„Also, was kann ich für Sie tun?“, fragte ich.
„Ich werde um Unterhalt für ein Kind erpresst, von dem ich bis gestern Abend nicht wusste, dass ich es habe.“ Er verschränkte die Arme, lehnte sich in seinem Stuhl zurück und wartete auf meine Reaktion.
Ich zog die Augenbrauen hoch, während er mir eine Geschichte über ein dunkles Motel, einen Parkplatz und Schatten erzählte. Bei meinen Fällen handelte es sich in der Regel um Scheidungen oder Klagen gegen einen Ehepartner auf zusätzliche Unterhaltszahlungen.
„Sie wollen also das Sorgerecht beantragen?“, fragte ich und schrieb eine kurze Liste von Punkten auf meinen Block. „Das ist ziemlich einfach. Wir stellen die Vaterschaft fest, dann klagen Sie auf das Sorgerecht. Wenn das Kind die gleiche DNA hat wie Sie, stehen die Chancen gut, dass Sie in irgendeiner Form das Sorgerecht bekommen. Wie viel Verantwortung wollen Sie?“
„Wenn ich ein Kind habe, will ich das volle Sorgerecht – wenn die Mutter wirklich tot ist. Ich will es kennenlernen, mehr als alles andere.“ Er nickte, räusperte sich dann jedoch. „Aber so einfach ist das nicht. Ich kann ihn nicht einfach auf das Sorgerecht verklagen oder das Gericht einschalten. Er wird verdammt schnell abhauen. Er hat wahrscheinlich einige Haftbefehle, und wenn jemand kommt und herumschnüffelt, dann ist mein Kind weg.“
„Oh.“ Ich runzelte die Stirn. Es lag Schmerz in seiner Stimme. Er wollte sein Kind wirklich kennenlernen und mein Herz zog sich ein wenig für ihn zusammen. „Ich bin Anwältin – Gerichte sind sozusagen mein Metier. Ich möchte Ihnen helfen, aber was genau wollen Sie?“
Er lehnte sich über meinen Schreibtisch. Meine Haut erhitzte sich, während sich diese kräftigen Schultern auf mich zubewegten. „Ich könnte es einfach mitnehmen, aber dann mache ich mich des Kidnappings schuldig, richtig? Ich will nicht, dass mein Kind denkt, ich hätte es der einzigen Familie weggenommen, die es je gekannt hat. Ich muss das richtig machen. Ich will nicht, dass es mir jemand wegnehmen kann.“
Er streckte die Hand aus und ergriff meine. Der Schmerz war deutlich in seinen Augen zu sehen, als er darüber sprach, dass er sein Kind nicht kannte. Ich hatte keine Ahnung, wie ich ihm helfen konnte, ohne das Gerichtssystem einzuschalten, aber ich wusste, dass ich es versuchen musste.
Ich drückte seine Finger.
„Zuerst sollten wir das Kind kennenlernen“, schlug ich vor. „Dann können wir uns einen Plan ausdenken.“
Skeeter
Ich wusste sofort, dass es meine Anwältin war, als das Auto auf den Parkplatz fuhr, wo Davide untergekommen war. Das perlweiß lackierte Mercedes-Coupé passte überhaupt nicht auf den mit Schlaglöchern übersäten Motelparkplatz. Hoffentlich würde niemand versuchen, ihn zu stehlen, während wir unser Vorhaben umsetzten. Sie trug einen marineblauen Hosenanzug und wirkte genauso deplatziert wie ihr Auto. Verdammt. Vielleicht war das doch keine so gute Idee gewesen.
„Er ist in dem da.“ Ich zeigte ihr Davides Zimmer. Es war das mit den billigen Plastikstühlen und dem Metalleimer für die Zigarettenkippen vor der Tür. „Davides Truck ist weg. Aber wir sollten trotzdem klopfen.“
„Lassen Sie mich das machen.“ Sie berührte meinen Arm. „Wenn das Kind allein dort ist, wirke ich weniger bedrohlich.“
Ich nickte. Ja, sie hatte Recht. Es war wohl das Beste, das Kind nicht gleich bei der ersten Begegnung zu erschrecken. Ich stellte mich an die Seite, während Miriam an die Tür des Motelzimmers klopfte. Es waren Stimmen zu hören, dann ein kleiner Knall. Zur Sicherheit schob ich Miriam hinter mich und wir warteten darauf, dass jemand öffnete.
Die Tür ging auf und die Brünette von neulich Abend schaute heraus. Ihr Haar war ungekämmt und ihre Augen fokussierten sich kaum, bis sie mich erblickte. „Skeeter?“, fragte sie und lachte.
Ich kannte sie irgendwoher. War sie vielleicht auf meiner Highschool gewesen? Allerdings Jahre später. Ihre Stimme wurde flach, ihre Augen verengten sich. Sie war nicht erfreut, mich zu sehen.
„Davide ist nicht da.“ Sie verdrehte die Augen und zündete sich eine Zigarette an. „Warum kommst du nicht später wieder?“
„Ist das Kind hier?“, fragte ich und versuchte, an ihr vorbei in den Raum zu schauen.
„Davide ist nicht hier.“ Sie zuckte mit den Achseln. „Das ist das Wichtigste.“
Ich kramte ein Bündel Bargeld heraus. „Fünfzig Mäuse. Betrachte es als Anzahlung in gutem Glauben.“ Ich winkte ihr mit den Scheinen und beobachtete, wie ihre abnorm kleinen Pupillen der Bewegung folgten. „Ich will das Kind sehen.“
Sie nahm mir das Geld aus der Hand und steckte es in ihren BH. Sie drehte sich um und schrie in das Motelzimmer. „Christophe, komm raus. Il est ton papa.“ Es ist dein Vater.
Cajun-Französisch – ich rief meine Mutter einmal im Monat oder so an, nur um diese Sprache zu hören. Ich hatte Louisiana vor zehn Jahren verlassen. Ich hatte Französisch, Langusten und mein Erbe zurückgelassen. Das Einzige, was mir geblieben war, war mein Dialekt.
„Englisch“, knurrte ich. Meine Anwältin musste alles verstehen, was wir sagten.
Sie starrte mich böse an. Ich versuchte, um sie herum in das dunkle Motelzimmer zu schauen, aber alles, was ich sehen konnte, waren zwei ungemachte Betten und ein Haufen Wäsche. Im hinteren Teil des Zimmers öffnete sich die Badezimmertür und ein kleiner Junge stolperte in den Raum. Er hatte einen roten Haarschopf und Sommersprossen.
Verdammte Scheiße.
Dieses Kind war eine Mini-Version von mir.
Ich musste ihn berühren, ihn kennenlernen.
Etwas strich über meine Schulter und ich blieb stehen. „Noch nicht“, murmelte Miriam. „Lassen Sie ihn rauskommen.“
Mein Sohn brauchte genau zwölf Schritte, um das winzige Motelzimmer zu durchqueren und zur Tür zu kommen. Ich ging in die Hocke und sah ihn an. Rotes Haar, Sommersprossen, meine Nase, mein Mund. Delphies Augen. Er war neun. Das musste er sein. Dann wäre Delphie gerade erst schwanger geworden, als ich zur Armee gegangen war.
„Hi.“ Was hätte ich sonst sagen sollen?
Das Kind lächelte. Mein Lächeln. Ich riss mich zusammen, als ich ins Schwanken geriet.
„Hi“, antwortete er.
Irgendwann hatte sich Miriam zu mir gesellt und hockte auf der Veranda des Motelzimmers. „Hi, mein Kleiner, ich bin Miri. Und wie heißt du?“
Der Junge sah mich an und dann wieder zu Miriam. „Christophe.“ Er sagte es genau so, wie ich es getan hätte, mit einem starken Vokal auf französische Art.
„Wie heißt dein Vater, Christophe?“, fragte Miriam weiter.
Fuck. Ich stützte mich mit der Hand auf dem Beton ab, um mich zu beruhigen. Ich musste Christophe meinen Namen sagen hören.
Er zuckte mit den Achseln. „Ich weiß es nicht. Onkel Davide sagte, er ist gestorben, als ich noch sehr klein war. Genau wie meine Mama.“
Es war, als hätte er mir ins Herz gestochen. Er war in dem Glauben aufgewachsen, seine Eltern seien beide tot. Ich nahm alles an meinem Sohn in mich auf. Alles, von seinen nackten Füßen bis zu seinem gewellten Haar. Es war nicht zu leugnen, dass er mein war. Ich wollte ihn nur an mich pressen und nicht mehr loslassen. Ich wollte die Hand nach ihm ausstrecken, aber Miriam zerrte an mir.
„Noch keine Umarmungen. Sie würden ihn erschrecken“, flüsterte sie.
Ich nickte und holte tief Luft. Mein Kind. Mein Sohn. Ich hatte einen Sohn.
„Vielleicht sollten wir uns in einem Park treffen?“, schlug Miriam vor. „Wir könnten mit Davide sprechen und Christophe ein wenig kennenlernen?“
Die Brünette nahm das Geld aus ihrem BH und begann es zu zählen. „Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Ich sage Davide Bescheid und er wird euch anrufen. Ich denke, ihr solltet jetzt gehen. Keine Zeit mehr ohne Davides Anwesenheit.“
Ich nickte, trat zurück und gab der Frau meine Telefonnummer. Ich konnte meinen Blick nicht von Christophe losreißen. Seine Sommersprossen waren genau wie meine.
Fuck. Ich hatte einen Sohn und jetzt musste ich ihn verlassen? Er war mein Sohn und ich wollte ihn bei mir haben. Ein beschissenes Motelzimmer mitten im Nirgendwo war kein Ort für ein Kind. Ich hasste es, dass Davide hier alle Trümpfe in der Hand hielt.
„Wir sollten gehen“, sagte Miriam und unterbrach meine Gedanken.
Ich sah an mir herunter und bemerkte, dass wir den ganzen Weg zu ihrem Auto gegangen waren und ich immer noch ihre Hand hielt.
„Scheiße, tut mir leid!“ Ich ließ sie los. Ich hatte sie schon zu Tode erschreckt, als wir uns getroffen hatten. Ich wollte nicht, dass sie sich bei ihrem Vater beschwerte. „Ich habe es nicht bemerkt.“
„Oh, das ist schon in Ordnung.“ Sie lächelte. „Es war ziemlich emotional für Sie. Denken Sie sich nichts dabei. Also, machen Sie ein Treffen mit Davide und Christophe aus. Ich will dabei sein, okay?“ Sie kramte in ihrer Handtasche und reichte mir ihre Visitenkarte. „Rufen Sie an und sagen Sie meiner Assistentin, wann alles stattfinden soll.“
Ich nahm ihre Karte. Schwarzer Schriftzug auf Weiß. Schlicht, professionell. Es passte zu ihr. Sie trug eine marineblaue Hose und eine Jacke. Davide würde wissen, dass etwas nicht stimmte, wenn sie das nächste Mal in einem ähnlichen Outfit auftauchte.
Ich konnte Davide noch nicht sagen, dass ich eine Anwältin hatte. Er würde sofort abhauen, falls er es erfuhr. Ich betrachtete sie von oben bis unten. Selbst unter dem ordentlichen Hosenanzug konnte ich erkennen, dass sie einen guten Körper hatte.
„Ich glaube, wir brauchen eine Tarngeschichte.“ Ich steckte die Visitenkarte in meine Tasche. „Ich kann ihm nicht sagen, dass Sie meine Anwältin sind, sonst macht er sich aus dem Staub und ich werde Christophe nie wieder sehen.“
„Guter Punkt.“ Sie nickte und biss sich auf die Lippe.
„Sie könnten meine Freundin sein.“ Ich schnallte meinen Helm fest und zwinkerte ihr zu.
Ihr Mund formte ein entzückendes kleines O, während sie mich schockiert anstarrte.
„Ich rufe dich an.“ Ich grinste. Es machte Spaß, meine Anwältin in Verlegenheit zu bringen.
Ich ließ den Motor aufheulen und freute mich darauf, auf die Autobahn zu fahren. Die offene Straße hatte sich immer wie ein Ort angefühlt, an dem ich keine Verantwortung und keine Sorgen hatte. Ich spürte, wie der Wind mich umwehte, aber dieses Mal verschwanden meine Probleme nicht. Das würden sie nie mehr. Ich war ein Vater von jemandem, der von mir abhängig war.
Ich hatte einen Sohn.